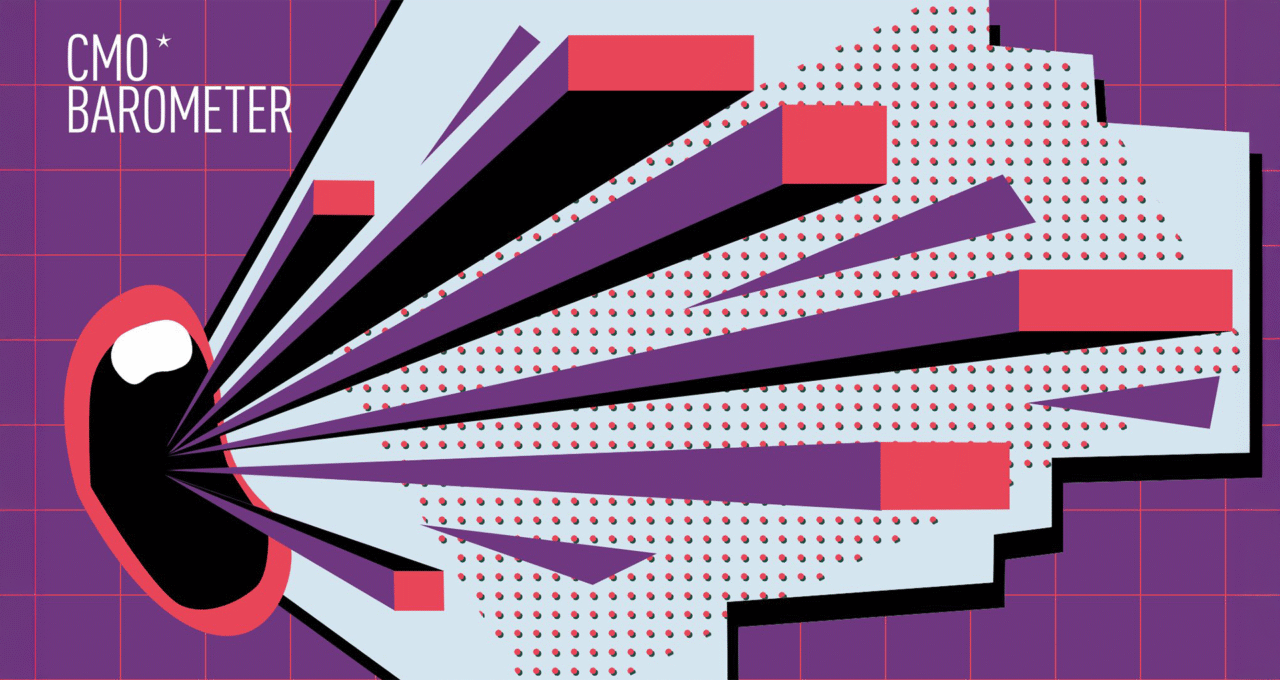Dienstag, 18. November 2025
Ohne staatliche Förderung ab 2026 droht dem Nationalen Register für angeborene Herzfehler das Aus – Patienten, Wissenschaft und Verbände schlagen Alarm
Das Nationale Register für angeborene Herzfehler (NRAHF) steht vor einer historischen Zäsur. Erstmals seit über zwei Jahrzehnten fließen keine staatlichen Mittel mehr, und ohne eine verbindliche Förderzusage ab 2026 droht das Aus einer der bedeutendsten Forschungsinfrastrukturen zur häufigsten Organfehlbildung des Menschen. Mehr als 60.000 Patientinnen und Patienten haben dem Register ihre Daten und Proben anvertraut – in der Erwartung, dass daraus lebensverbessernde Erkenntnisse entstehen. Nun steht diese Basis akut auf dem Spiel.
Die Hoffnung ruht aktuell auf dem neu aufgestellten Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) sowie auf dem Bundestag. Denn was im Kern gefährdet ist, hat enorme gesellschaftliche Tragweite: Alle 90 Minuten wird in Deutschland ein Baby mit einem angeborenen Herzfehler geboren, jährlich rund 7.000 Kinder. Über eine halbe Million Betroffene leben heute bundesweit mit einer solchen Diagnose – viele benötigen lebenslange spezialisierte Versorgung. Ohne kontinuierliche Forschung bleiben Risiken unentdeckt und Behandlungspfade unklar.
Die Stimmen von Eltern, Betroffenen und Expertinnen verdeutlichen die Dramatik. Familien wie die von Michelle Wagner, deren Tochter Edith dank moderner Kinderherzmedizin überlebte, betonen die Relevanz des Registers: „Die Arbeit des Nationalen Registers ist Gold wert und existenziell notwendig.“ Ähnlich schildern es Katrin und Patrick, deren Sohn Jonas als 50.000ster Teilnehmender registriert wurde. Auch Erwachsene mit angeborenem Herzfehler wie Christina Pack oder Johanna Schlögl appellieren eindringlich an die Politik, die Forschung nicht abzubrechen.
Medizinische Fachvertreter unterstreichen die Konsequenzen eines Stillstands. Privatdozentin Dr. Constanze Pfitzer vom Deutschen Herzzentrum der Charité mahnt: „Herzfehler ist nicht gleich Herzfehler. Über 200 verschiedene Fehlbildungen existieren – wir müssen sie verstehen, um Menschen bis ins Alter optimal versorgen zu können.“ Prof. Dr. Dr. Gerhard-Paul Diller vom Universitätsklinikum Münster ergänzt, dass die Langzeitforschung nur mit vielen Tausend Datensätzen valide Antworten liefern kann. Prof. Dr. Marc-Phillip Hitz verweist zudem auf die internationale Relevanz: Der Daten- und Probenschatz sei weltweit einmalig und Grundlage für neue Therapieansätze.
Auch gesellschaftlicher Rückhalt wächst. Rund 38.000 Menschen unterstützen die Petition auf innn.it, nachdem im Sommer bereits über 15.000 Bürgerinnen und Bürger eine Bundestagspetition unterzeichnet hatten. Zusätzlichen Schub bringt eine Digital-Out-of-Home-Kampagne von Ströer, die zwei Wochen lang an großen Bahnhöfen sichtbar war. Das Motiv „Jedes Herz zählt“ wurde bundesweit verbreitet und sorgte für erhebliche Aufmerksamkeit.
Die Initiatoren rufen weiterhin zur Unterstützung auf – online, per Unterschriftenliste oder über Aktionen in Gemeinden, Unternehmen und sozialen Netzwerken. Spendenmöglichkeiten ergänzen das Engagement, um kurzfristige Forschungsspielräume abzusichern. Doch klar bleibt: Eine nachhaltige staatliche Finanzierung ist unverzichtbar.
Ob die über Jahrzehnte aufgebaute Forschungsgrundlage erhalten bleibt, entscheidet sich in den kommenden Monaten. Für Tausende Familien und Patienten wäre ein Wegbrechen dieser Ressource ein massiver Rückschritt. Jede Stimme, jede Unterschrift und jede öffentliche Unterstützung kann dazu beitragen, dass das Register weiterbesteht – für die Betroffenen von heute und die Generationen von morgen.